- Start »
- Themen »
- AKW-Generation IV »
- Schöne neue Reaktorwelt? Generation IV, SMR & Co.

Probleme und Risiken „neuer“ Reaktoren
Ob Generation-IV-Reaktoren, SMR oder Kernfusion – die angeblich fortschrittlichen Konzepte bleiben teuer, riskant und ungeeignet für den Klimaschutz. Sicherheitsrisiken sind ungelöst, Atommüll bleibt ein Problem, und die erhofften Innovationen existieren oft nur auf dem Papier. Während Milliarden in die Atomforschung fließen, drängt die Klimakrise zum schnellen Ausbau der Erneuerbaren.
Sicherheit ist eine Illusion
Neue Reaktorkonzepte werden zwar als sicherer beworben, doch Expert*innen erwarten keine großen sicherheitstechnischen Fortschritte. Da die meisten Konzepte nur als Powerpoint-Präsentation oder im Labor existieren, sind die Sicherheitskonzepte weder ausgereift noch überprüfbar. Bei anderen Konzepten, für die in der Vergangenheit bereits Prototypen oder Versuchsreaktoren gebaut wurden – etwa der Kugelhaufenreaktor in Jülich oder der schnelle Brüter in Hamm-Uentrop – traten im Betrieb gravierende Probleme auf, die man nicht vorhergesehen hatte. Der Teufel steckt wie so oft im Detail.
Ein Beispiel dafür, wie neue Reaktoren sicherer werden sollen: Passive Sicherheitssysteme sollen ohne externe Energiezufuhr funktionieren. Doch auch hier fehlen konkrete Sicherheitsnachweise. Expert*innen befürchten zudem, dass die erwarteten Vorteile solcher Systeme die Entwickler*innen dazu verleiten könnten, wichtige Prinzipien wie Redundanz (mehrere voneinander unabhängige Systeme) und Diversität (unterschiedliche Systeme mit gleicher Funktion) zu vernachlässigen, die bei heutigen Reaktoren Standard sind.
Weltweit verstreut, leicht verwundbar
Neue Reaktorkonzepte bergen erhebliche Proliferationsrisiken. Wie groß die Gefahr der Weitergabe von spaltbarem Material oder Know-how ist, hängt von Konzept, Reaktordesign und Brennstoff ab. Besonders SMR würden eine lückenlose Kontrolle erschweren, da sie weltweit verteilt wären. Einige Generation-IV-Reaktoren könnten sogar waffenfähiges Plutonium in Reinform produzieren. Selbst vermeintlich „sichere“ Brennstoffe wie Tritium und Thorium sind problematisch: Tritium dient als „Booster“ für Atomwaffen, und aus Thorium lässt sich relativ leicht waffenfähiges Uran-233 gewinnen. Aus einem Thoriumreaktor ausreichend Material für den Bombenbau abzuzweigen, wäre sogar relativ einfach.
Keine Lösung der Atommüllfrage
Neue Reaktorkonzepte bieten keine Lösung für die Atommülllagerung. Die Zusammensetzung des Abfalls variiert je nach Konzept erheblich, doch langfristige Vorteile gibt es kaum. Transmutation soll langlebigen Müll in kurzlebigere radioaktive Stoffe umwandeln, doch das erfordert den Aufbau einer Atomindustrie, für die nicht einmal die nötigen Reaktoren existieren. Zudem eignet sich ein erheblicher Teil des vorhandenen Atommülls ohnehin nicht für dieses Verfahren – insbesondere langlebige Spaltprodukte lassen sich nicht umwandeln. Die Lagerung radioaktiver Abfälle über eine Million Jahre bleibt unvermeidlich. Selbst die Kernfusion produziert radioaktiven Abfall – mit kürzerer Strahlungsdauer, aber in großen Mengen durch kontaminierte Reaktorbauteile.
Milliardengrab
Atomenergie war schon immer unwirtschaftlich. Befürworter*innen behaupten zwar, ein Wechsel von Groß-AKW hin zur Serienfertigung kleinerer Reaktoren könne das Kostenproblem lösen. Doch Bau, Betrieb, Unterhalt, Kontrolle und Rückbau vieler kleiner AKW wären unterm Strich wahrscheinlich sogar viel teurer – vor allem, wenn sie dieselben oder höhere Sicherheitsanforderungen als heutige AKW erfüllen müssen.
Ob eines der diskutierten Reaktormodelle jemals kommerziell genutzt werden kann, ist völlig ungewiss. Dennoch fließen weiter große Summen in die Reaktorforschung. Auch als Mitglied der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) beteiligt sich Deutschland mit öffentlichen Geldern und Forschungseinrichtungen an der Reaktorentwicklung – trotz „Atomausstieg“.
Irrweg in der Klimakrise
Auch Atomkraft verursacht Treibhausgasemissionen. Sie ist jedoch vor allem aus einem anderen Grund ein Irrweg in der Klimakrise: Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen die Emissionen sehr schnell sinken. All die neuartigen Reaktoren, von denen es nicht einmal funktionierende Prototypen gibt, kommen dafür zu spät – wenn überhaupt. Jeder Euro, der in Atomkraft fließt, wäre in wirksamen Klimaschutz besser investiert. Erneuerbare Energien sparen pro Euro deutlich schneller und mehr Treibhausgase ein als Atomkraft. Jede Investition in Atomkraft ist daher letztlich schädlich fürs Klima.
Atomkraft bleibt gefährlich, schmutzig und teuer
Sichere, saubere und billige Atomenergie ist und bleibt ein Mythos. Auch die angeblich „neuen“ Reaktoren lösen das grundsätzliche Problem nicht, dass die Technik ein untragbares Risiko für Mensch und Natur darstellt. Zudem bieten diese Konzepte keine Lösung für den verantwortungsbewussten Umgang mit strahlendem Abfall. Statt in Atomkraft zu investieren, die die Klimakrise nur weiter verschärft, sollten vorhandene Alternativen zum Einsatz kommen. Zukunftsfähige Energieversorgung braucht keine Atomkraft.
TERRA-X: Mini-Kernkraftwerke: Der Weg aus der Klimakrise?
Harald Lesch erläutert, warum SMR kein Weg aus der Klimakrise sind.
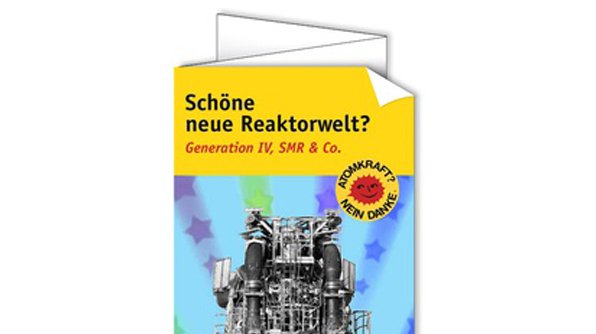
Flyer: Schöne neue Reaktorwelt?
Du willst Dein Wissen teilen? Unser kostenloser Flyer mit Argumenten gegen „neue“ Reaktoren hilft Dir dabei. »

