- Start »
- Themen »
- Atomunfall »
- Fukushima

Die Atomkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011
Radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pazifik?
Japan leitet seit dem 24. August 2023 gefiltertes, aber noch radioaktiv verseuchtes Wasser aus dem havarierten Kernkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer. Wie auch anderswo sollen die radioaktiven Hinterlassenschaften der Atomkraft unsichtbar gemacht werden, weil eine langfristige Lösung nicht existiert.
Auch 13 Jahre nach der Katastrophe müssen die havarierten Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden. Es existieren keine geschlossenen Kühlkreisläufe, daher nimmt dessen Menge täglich zu. Inzwischen lagern mehr als 1,3 Millionen Tonnen verstrahltes Kühlwasser auf dem Gelände. Dieses Wasser leitet Japan jetzt ins Meer ab. Es wird zwar gefiltert und verdünnt, enthält aber weiterhin diverse Radionuklide – neben Tritium beispielsweise Cäsium 134/137, Strontium 90, Kobalt 60, Kohlenstoff 14 und Jod 129.
Die Auswirkung von Tritium und der anderen Radionuklide auf das Ökosystem und die Nahrungskette ist wenig untersucht. Langzeitfolgen werden nicht berücksichtigt. Fraglich ist auch, wie sich einzelne Radionuklide im Meerwasser verhalten, in der Nahrungskette anreichern und was für Schäden sie dabei anrichten.
Deshalb: Das Kühlwasser in Fukushima muss weiterhin in Tanks streng kontrolliert aufbewahrt bleiben und darf nicht in den Pazifik geleitet werden.
→ Mehr Details im Forderungsschreiben der Yosomono-Net (Netzwerk von japanischen Anti-Atom-Gruppen im Ausland)
Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr ereignet sich vor der Ostküste Japans, 130 Kilometer östlich von Sendai, ein schweres Seebeben (Stärke 9,0 auf der Richterskala). Die Erdstöße verursachen gravierende Schäden im AKW Fukushima Daiichi, die nachfolgende Flutwelle (Tsunami) verschärft die Situation noch. Stromversorgung und Kühlung aller sechs Reaktoren sowie der sieben Abklingbecken mit hochradioaktiven Brennelementen fallen aus. Die Blöcke 4 bis 6 sind wegen Wartungsarbeiten zufällig außer Betrieb, in den Blöcken 1 bis 3 jedoch scheitern trotz Schnellabschaltung alle Versuche, die Reaktoren ausreichend zu kühlen. In allen drei Reaktoren kommt es deshalb zur Kernschmelze und somit zum Super-GAU – in Block 1 bereits am 12. März, in den Blöcken 2 und 3 wenige Tage später. Explosionen in den Blöcken 1 bis 4 zerstören unter anderem die Gebäudehüllen.
Wochenlang ziehen immer neue radioaktive Wolken von Fukushima aus über Japan und/oder den Pazifik. Unter anderem lässt AKW-Betreiber TEPCO mehrfach radioaktiven Dampf ab, um Explosionen im Innern der Reaktoren zu verhindern, die eine noch größere Freisetzung radioaktiver Stoffe zur Folge hätten haben können.
Neben den sechs Reaktoren in Fukushima-Daiichi kommt es aufgrund des Erdbebens auch in den vier Reaktoren des AKW Fukushima-Daini, den drei Reaktoren des AKW Onagowa, im AKW Tōkai-2 sowie in der Wiederaufarbeitungsanlage Rokkasho zu kritischen Situationen wie dem Ausfall von Stromversorgung und/oder Kühlung. Sie können jedoch noch rechtzeitig wieder unter Kontrolle gebracht werden.

Virtuelle Ausstellung: "Fukushima, Tschernobyl und wir"
Was genau ist in Fukushima und Tschernobyl passiert? Welche Auswirkungen haben die Unfälle bis heute? Die virtuelle Ausstellung gibt Antwort. »

Veranstaltungen zum Fukushima-Jahrestag
Zum 13. Jahrestag von Fukushima und 1 Jahr nach Abschalten der letzten AKW in Deutschland zeigt .ausgestrahlt eine Reihe von Online-Veranstaltungen mit verschiedenen Referent*innen. »
Bücher zu Fukushima – Unsere Empfehlungen
Alexander Tetsch: „Fukushima 360 Grad - das atomgespaltene Leben"
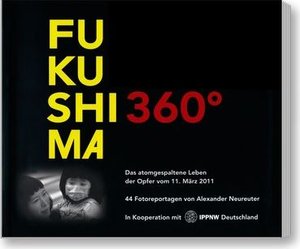
Im Mai 2013 reiste der Fotograf Alexander Tetsch (geb. Neureuter) 4.000 Kilometer quer durch Japan. Anhand von 44 Einzelschicksalen zeigt er, wie sich das Leben für die Menschen vor Ort unwiderruflich verändert hat. Sein Bildband, erschienen in Kooperation mit der Ärztevereinigung IPPNW (Ärzte gegen Atomkrieg), zeigt die tief in den Alltag eingedrungene Präsenz der Nuklearkatastrophe.
204 Seiten, 158 meist großformatige Farbfotografien. Neureuters 2011, ISBN 978-3-00-044733
Katsuhiro Ichikawa 2014: Zuhause in Fukushima. Das Leben danach: Portraits mit Fotos
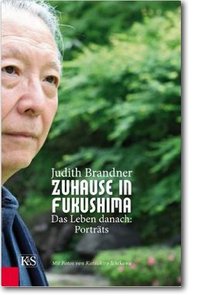
Kei Kondo hat seinen Bio-Bauernhof verloren. Sadako Monma musste ihren Kindergarten schließen. Der Arzt und Diplomat Ryohei Suzuki kehrte nach der Katastrophe nach Fukushima zurück, um im dortigen Krankenhaus zu arbeiten. Judith Brandner erzählt in diesem Buch in 13 sensiblen Porträts, wie sich die Katastrophe von Fukushima auf die dort lebenden Menschen auswirkt. Der japanische Fotograf Katsuhiro Ichikawa hat Judith Brandner bei ihren Recherchen begleitet und die Menschen fotografiert, mit denen sie gesprochen hat. Die Fotos zeigen auf berührende Weise, wie die Menschen heute dort leben und fühlen.
160 Seiten, Kremayr & Scheriau 2014, ISBN-10: 3218009065
Lisette Gebhardt, Steffi Richter (Hrsg.): Lesebuch Fukushima
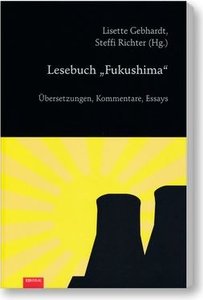
Kurz nach der Dreifachkatastrophe in Fukushima wurde die Textinitiative Fukushima gegründet, die japanische Texte ins Deutsche übersetzt und so auch diejenigen an der innerjapanischen Debatte um Fukushima teilhaben lässt, die kein Japanisch verstehen. Die Ergebnisse wurden nun in einem Lesebuch veröffentlicht. Das Lesebuch ist interdisziplinär ausgerichtet und enthält vier Themenkomplexe: Atompolitik in Japan, Kunst nach Fukushima, Medienmanipulation durch die Atomlobby und Anti-AKW Proteste nach Fukushima.
Eb-Verlag 2013, 442 Seiten, ISBN:978-3868931037
Susan Boos: Fukushima lässt grüßen
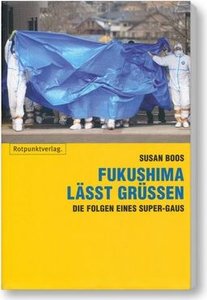
Man muss sich vorstellen können, was ein Super-GAU in unmittelbarer Nähe mit der eigenen Welt anrichten würde. Nach der Fukushima-Katastrophe reiste Autorin Susan Boos nach Japan, um das Geschehen in den verstrahlten Gebieten zu dokumentieren. Boos analysiert die Ereignisse und fragt: Was wäre, wenn ein solches Unglück in der Schweiz oder in Deutschland geschähe? Wie würde evakuiert? Wohin? Wer räumt auf? Wer trägt die Kosten?
271 Seiten, kartoniert, Rotpunktverlag 2012, ISBN-10: 3858694746
Coulmas, Florian / Stalpers, Judith: Fukushima. Vom Erdbeben zur atomaren Katastrophe
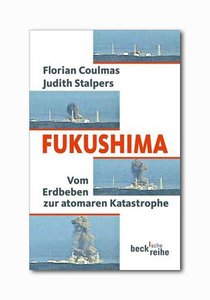
Florian Coulmas und Judith Stalpers schildern in diesem Buch den verheerenden Verlauf des großen Bebens, analysieren, wie es zur Havarie der Reaktoren kommen konnte und beschreiben, wie die japanische Gesellschaft mit der Katastrophe umgegangen ist. Dabei lassen sie persönliche Erfahrungen und Erlebnisse einfließen und hinterfragen die Klischees der westlichen Berichterstattung. So entsteht eine subtile Einführung in das heutige Japan und seine besonderen Mentalitäten, Prägungen und Strukturen. Am Ende steht die Frage nach der Zukunft und den Folgen, die die Katastrophe für das Land haben wird.
192 Seiten, 30 Abbildungen und 8 Tabellen. Paperback, C.H.BECK 2011, ISBN 978-3-406-62563-3
Manga: Daisy aus Fukushima - Ein Comic im japanischen Stil von Reiko Momochi
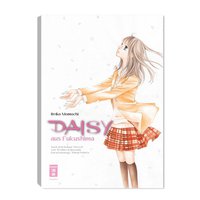
Anderthalb Monate nach dem verheerenden Erdbeben vom 11. März 2011 kehrt Fumi an ihre Schule in Fukushima zurück. Es war eine unfreiwillige Schulpause, in der sich so vieles verändert hat … Die Strahlung und die damit verbundene Unsicherheit ist allgegenwärtig: Fumis kleiner Bruder darf nicht mehr draußen spielen und ein kleiner Regenschauer genügt, um die Schüler panikartig unter das Schuldach flüchten zu lassen. Fumi und ihre Freundinnen wollen sich davon aber nicht ihre Jugend kaputtmachen lassen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Auswirkungen der Katastrophe ziehen immer weitere Kreise …
340 Seiten, von rechts nach links zu lesen, Egmont 2016, ISBN 978-3-770-49162-9
Fotos aus Fukushima
alle Fotos von Alexander Tetsch aus dem Bildband: Fukushima 360°
Studien zum Thema
-
Radiation Reloaded - Ecological Impacts of the Fukushima Daiichi Nuclear Accident 5 years later (3/2016 Greenpeace)
-
Gesundheitliche Folgen der Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima (2/2016 IPPNW)
-
Auswirkungen von Tschernobyl und Fukushima auf die Tierwelt (11/2014 IPPNW)
-
Über 100 Schilddrüsenkrebsfälle in der Präfektur Fukushima (8/2014 IPPNW)
-
Fukushima-Strahlung höher als angenommen (10/2011 Bericht auf Spiegel Online)
















